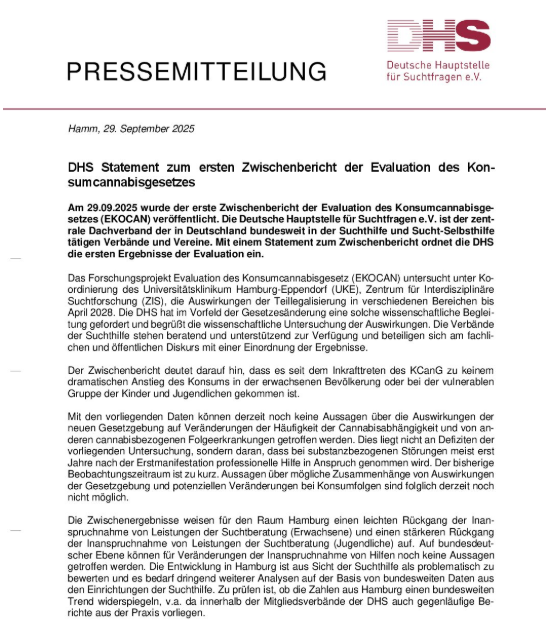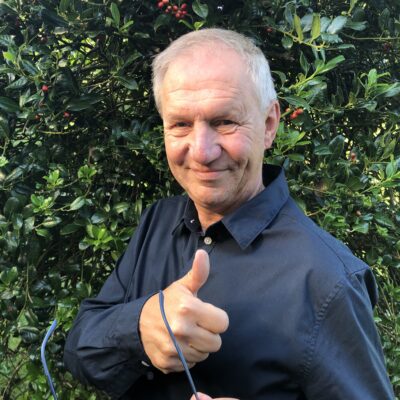Das vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf koordinierte Forschungsprojekt EKOCAN untersucht bis 2028 die Auswirkungen der Cannabis-Teillegalisierung in Deutschland. Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) hatte eine wissenschaftliche Begleitung des Projekts schon früh gefordert und begrüßt die laufende Evaluation.
Erste Ergebnisse: Kein Konsum-Anstieg bei Jugendlichen
Der Zwischenbericht zeigt, dass sich der Konsum von Cannabis bei Erwachsenen oder Jugendlichen seit Inkrafttreten des Konsumcannabisgesetzes (KCanG) nicht deutlich erhöht hat. Aussagen zur Cannabisabhängigkeit oder zu anderen gesundheitlichen Folgen sind derzeit jedoch nicht möglich, da der Beobachtungszeitraum noch zu kurz ist.
Suchtberatung: Rückgänge in Hamburg
Für Hamburg weist die Studie auf einen leichten Rückgang der Suchtberatung bei Erwachsenen und einen deutlichen Rückgang bei Jugendlichen hin. Ob dies ein bundesweiter Trend ist, bleibt offen. Die DHS sieht hier dringenden Analysebedarf und fordert eine bessere Abstimmung zwischen Behörden, Jugendhilfe, Polizei und Suchthilfe, um frühzeitig auf problematischen Konsum reagieren zu können.
Prävention: Hohe Nachfrage, zu wenig Ressourcen
Viele Einrichtungen melden einen großen Bedarf an Präventionskursen, der aufgrund fehlender Ressourcen bislang nicht gedeckt werden kann. Die DHS fordert deshalb eine flächendeckende Stärkung der Präventionsarbeit.
Medizinalcannabis: Grauzonen und neue Vertriebswege
Der Gesetzgeber unterscheidet deutlich zwischen Medizinal- und Konsumcannabis. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass sich medizinischer Gebrauch und Freizeitkonsum häufig überschneiden und nicht immer eindeutig voneinander getrennt werden können. Der geschätzte Gesamtbedarf an Cannabis lag im Jahr 2024 bei 670 bis 823 Tonnen, wovon rund 12 bis 14 Prozent durch Medizinalcannabis gedeckt wurden.

Ein wachsender Bereich ist die telemedizinische Verschreibung: Über Onlineplattformen wie „Dr. Ansay“, „DoctorABC“ oder „MedCanOneStop“ können Patient*innen Rezepte ohne Praxisbesuch erhalten und bestimmte Sorten gezielt auswählen. Zwar verstoßen Teile dieses Geschäftsmodells gegen das Heilmittelwerbegesetz, dennoch bleibt der Zugang auf diesem Weg vergleichsweise unkompliziert.
Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass Cannabis aus illegaler Produktion in den Medizinalmarkt gelangt. Zwar gibt es dafür bisher keine eindeutigen Belege, doch die Überschneidung der Märkte wirft Fragen auf. Für die Evaluation des KCanG ist das Angebot an Medizinalcannabis daher von zentraler Bedeutung.
Der Schwarzmarkt bleibt ein Problem.
Trotz der Gesetzesänderung haben Konsumenten weiterhin nicht überall Zugang zu qualitativ gesicherten Cannabisprodukten. Der Schwarzmarkt spielt noch immer eine große Rolle und birgt zusätzliche Gesundheitsrisiken.
Fazit:
Die bisherigen Ergebnisse machen deutlich: Ein Konsum-Boom ist durch die Legalisierung bislang nicht entstanden, gleichzeitig bestehen jedoch Defizite bei Prävention, Beratung und Produktsicherheit. Die DHS fordert eine Weiterentwicklung des KCanG mit Fokus auf Gesundheits-, Jugend- und Verbraucherschutz.
Einordnung der DHS: